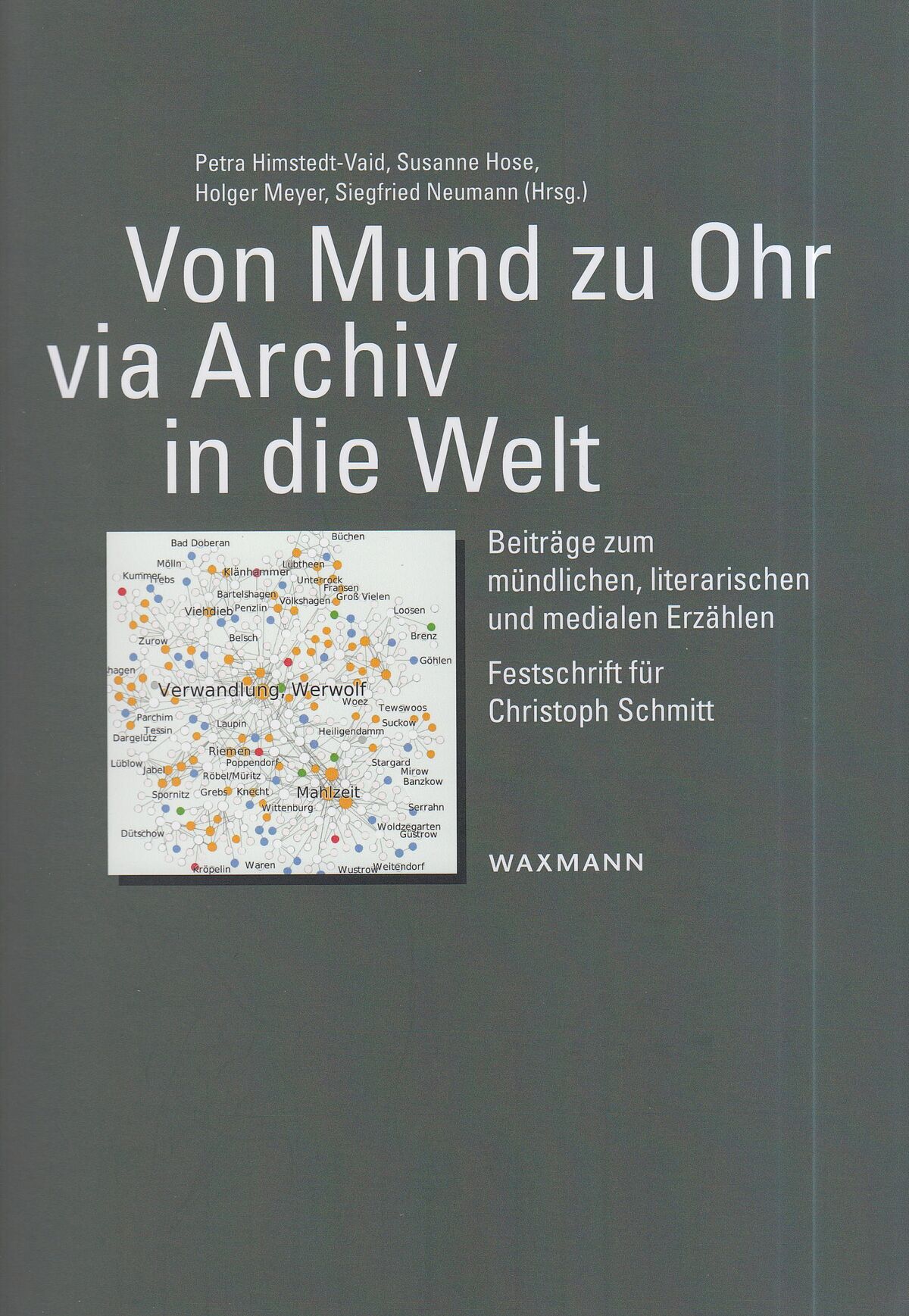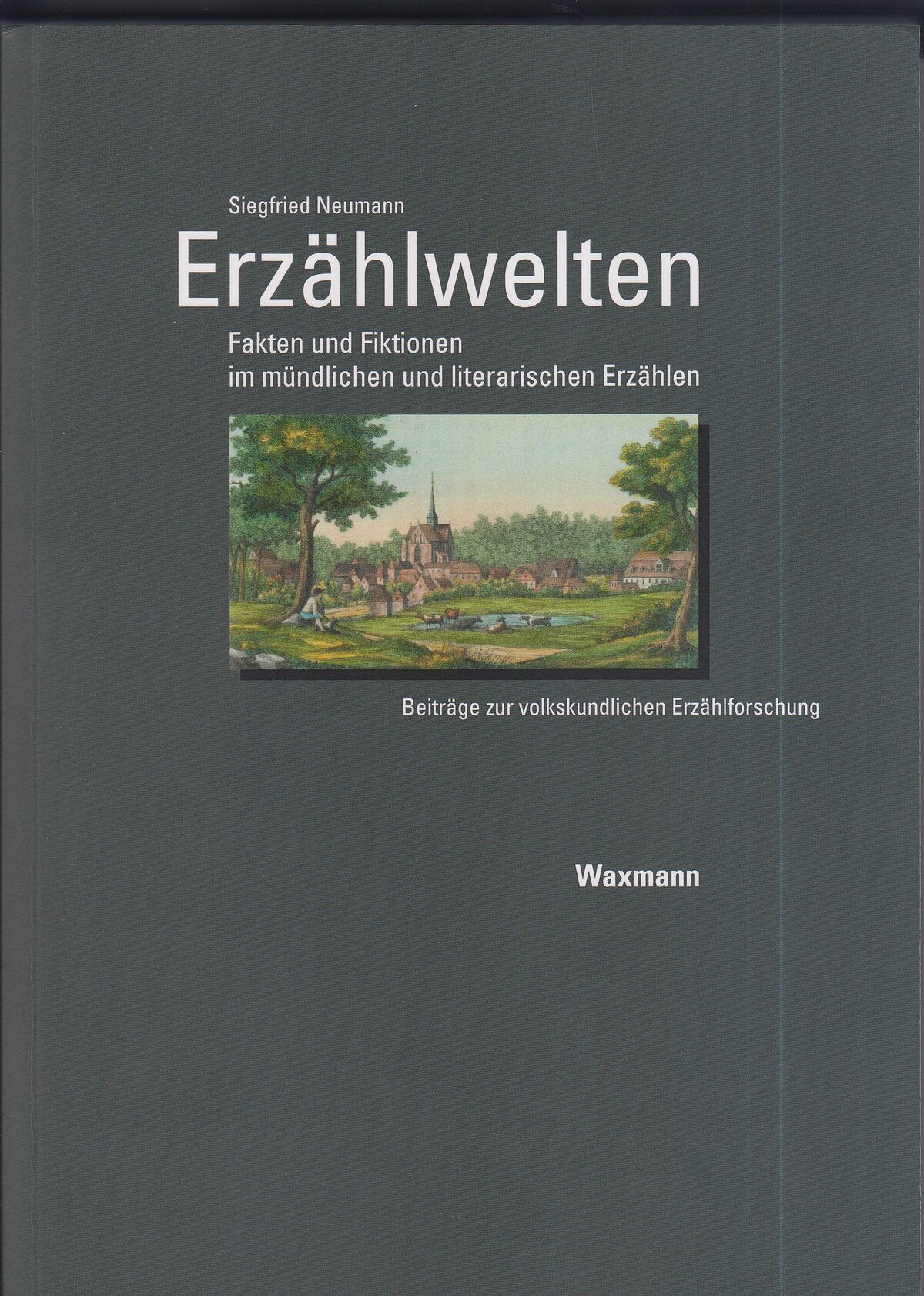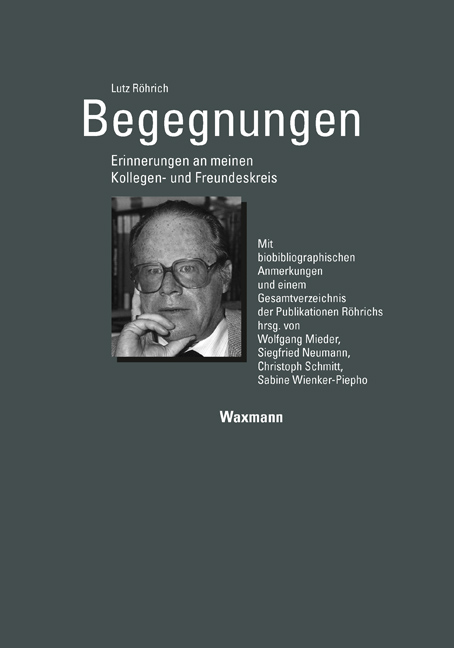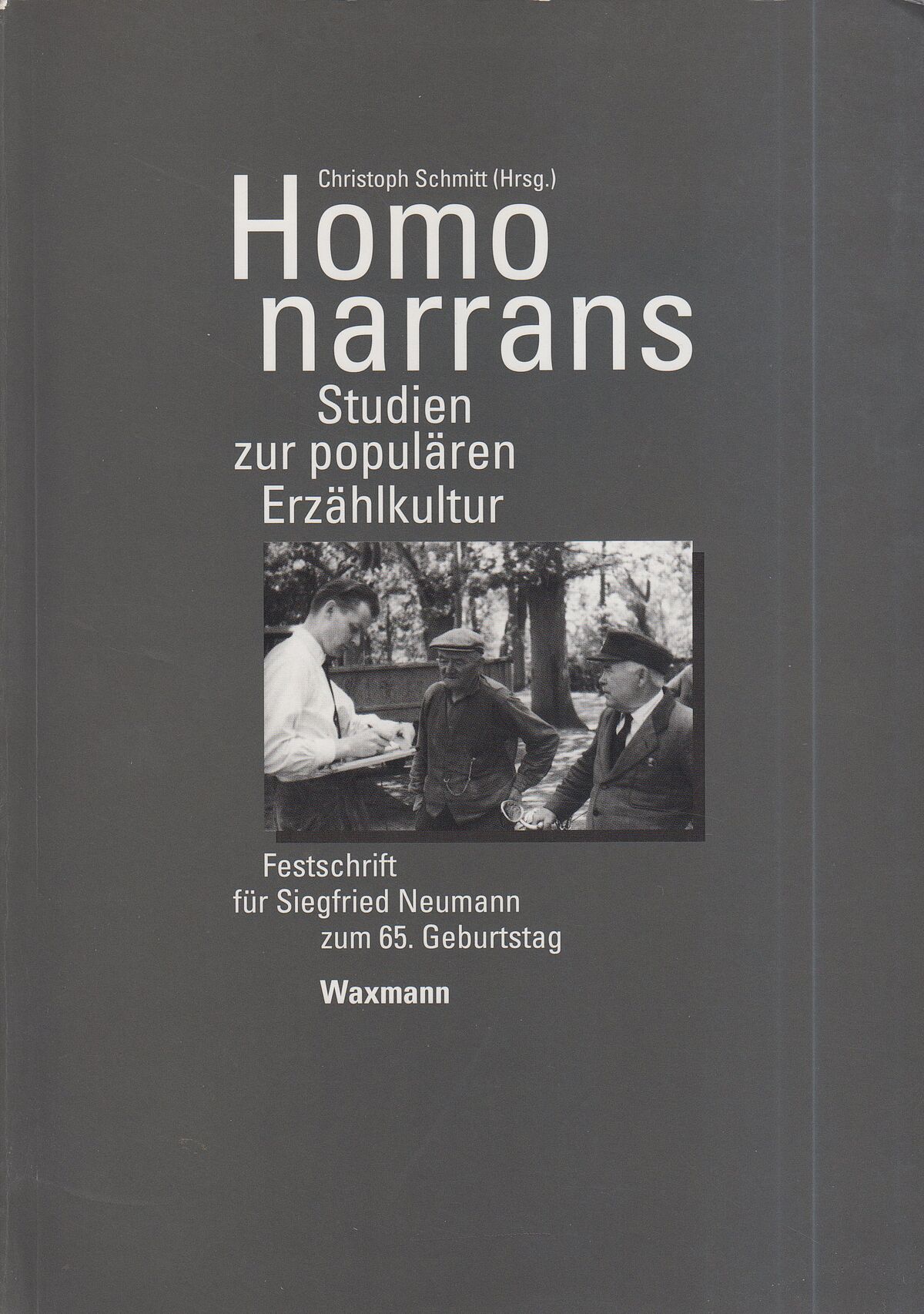Band 9: Von Mund zu Ohr via Archiv in die Welt. Beiträge zum mündlichen, literarischen und medialen Erzählen. Festschrift für Christoph Schmitt.
Petra Himstedt-Vaid, Susanne Hose, Holger Meyer und Siegfried Neumann (Hgg.): Von Mund zu Ohr via Archiv in die Welt. Beiträge zum mündlichen, literarischen und medialen Erzählen. Festschrift für Christoph Schmitt (= Rostocker Beiträge zur Volkskunde und Kulturgeschichte, 9). Münster/New York: Waxmann 2021.
Klappentext:
Von Mund zu Ohr via Archiv in die Welt – Erzählungen wandern. Wer sich mit dem alltäglichen Erzählen etwa von Gerüchten, Witzen oder Anekdoten bzw. von Sagen, Märchen und Rätseln auseinandersetzt, kommt nicht umhin, die Wege und Medien, die jene Erzählungen nutzen, sowie damit einhergehende Wandelprozesse unter die Lupe zu nehmen. Gerade solche Forschungen zu Erzählkulturen im Medienwandel prägen den wissenschaftlichen Werdegang von Christoph Schmitt. In dieser Festschrift anlässlich seines 65. Geburtstages möchten ihm mehr als vierzig Kolleginnen und Kollegen mit ihren Beiträgen Dank und Anerkennung zollen. Im Zentrum stehen dabei immer wieder die eindrucksvollen Bestände des Wossidlo-Archivs, das seit 1999 unter der Leitung Christoph Schmitts steht. Mit der Digitalisierung dieser Bestände eröffnet er 'der Welt' den freien Zugang zu einer wichtigen ethnografischen Sammlung im deutschsprachigen Raum. Er bereitet damit zugleich den darin enthaltenen Erzählungen neue Wege 'in die Welt'.
Band 8: Siegfried Neumann: Erzählwelten. Fakten und Fiktionen im mündlichen und literarischen Erzählen. Beiträge zur volkskundlichen Erzählforschung.
Siegfried Neumann: Erzählwelten. Fakten und Fiktionen im mündlichen und literarischen Erzählen. Beiträge zur volkskundlichen Erzählforschung (= Rostocker Beiträge zur Volkskunde und Kulturgeschichte, 8). Münster/New York: Waxmann 2018.
Klappentext:
Dieser Band der "Rostocker Beiträge zur Volkskunde und Kulturgeschichte" mit Studien des renommierten Erzählforschers Siegfried Neumann führt eine Reihe von Erzählwelten vor, deren Dokumentation und Untersuchung sich vom Vineta-Mythos über die vielfältigen Inhalte der Popularliteratur und Volkserzählung der folgenden Jahrhunderte bis hin zu den vom mündlichen Erzählen beeinflussten Natur- und Gesellschaftsschilderungen deutscher Dichter des 19. Jahrhunderts erstreckt. Dabei geht es dem Autor sowohl um den Reichtum der erzählten Inhalte wie um die Erzählformen, um die verschiedenen Darstellungsweisen des Erzählten und um die Erzählerpersönlichkeiten, von denen das Erzählte stammt. Im Ergebnis zeigt sich eine breite Palette der erzählerischen Darbietungskunst und des Aussagewollens, die von der angestrebten Abbildung wirklichen oder denkbaren Geschehens bis zu märchenhaften Schöpfungen kreativer Phantasie reicht, wobei die Grenzen zwischen mündlicher Erzählung und literarischer Gestaltung, wiewohl scheinbar vorgegeben, weithin fließend sind. Hier tun sich originelle Forschungsansätze auf.
Band 7: Lutz Röhrich: Begegnungen. Erinnerungen an meinen Kollegen- und Freundeskreis. Mit biobibliographischen Anmerkungen und einem Gesamtverzeichnis der Publikationen Röhrichs.
Lutz Röhrich: Begegnungen. Erinnerungen an meinen Kollegen- und Freundeskreis. Mit biobibliographischen Anmerkungen und einem Gesamtverzeichnis der Publikationen Röhrichs, hg. von W. Mieder, S. Neumann, C. Schmitt, S. Wienker-Piepho (= Rostocker Beiträge zur Volkskunde und Kulturgeschichte). Waxmann 2016.
Klappentext:
Auf internationalen Zusammenkünften grüßten ihn viele mit „Mr. Folklore of Germany“ – Lutz Röhrich, dessen Arbeiten zur Erzähl-, Lied- und Redensartenforschung ihn zu einem Wissenschaftler von Weltruf werden ließen. Früh gelang es ihm, die vom Nationalsozialismus beschwerte deutschsprachige Erzählforschung wieder zu internationalisieren. In Mainz und als Freiburger Ordinarius, der hier zugleich das Deutsche Volksliedarchiv leitete, begeisterte er Generationen von Schülerinnen und Schülern für die Volkskunde, die später ihrerseits das Fach prägten, wie es ihm ebenso gelang, auch breitere Kreise mit seinen Schriften anzusprechen. Zu einer Art „Hausbuch“ avancierte denn auch Röhrichs „Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten“.
Dieser Band versammelt anekdotische Erinnerungen an Kolleginnen, Kollegen und Weggefährten, die der im hohen Alter erblindete Gelehrte nur für den engeren Freundeskreis diktieren wollte. Kurz vor seinem Tode äußerte Lutz Röhrich jedoch intuitiv den Wunsch, dass seine vignettenartigen Erzählungen trotz ihres fragmentarischen Charakters erscheinen sollten. Mit vielfachen Anspielungen, die den Leser schmunzeln lassen, dokumentieren die „Begegnungen“ die subjektive Sicht eines der Folkloristik nahestehenden leidenschaftlichen Volkskundlers auf die Fachentwicklung. Erzählend veranschaulicht Röhrich, wie fruchtbar neues Wissen im Dialog, in der gelebten Freundschaft mit anderen, geschaffen werden kann.
Um die Lektüre zu erleichtern, wurden Erläuterungen hinzugefügt und die erwähnten Personen des weit gespannten Netzwerkes mit Kurzbiographien versehen. Beeindruckend ist das Schriftenverzeichnis, das nun Röhrichs gesamtes publizistisches Werk einschließlich entlegener Beiträge und seine Leistung als Autor ethnographischer Filme erfasst.
Band 6: Kantor Friedrich August Rehm. Eine Studie zur Situation mecklenburgischer Dorfschullehrer im letzten Jahrhundert der Monarchie

Walter F. Rehm: Kantor Friedrich Rehm. Eine Studie zur Situation mecklenburgischer Dorfschullehrer im letzten Jahrhundert der Monarchie (= Rostocker Beiträge zur Volkskunde und Kulturgeschichte, 6). Waxmann 2015.
Klappentext:
Das 19. Jahrhundert brachte für Mecklenburgs Landschulen den Übergang von den aus Handwerkern und Küstern hervorgegangenen Landschulmeistern hin zu einer qualifizierten, in Präparanden und Seminaren ausgebildeten Lehrerschaft. Seminarlehrer, berufen aus dem fortschrittlicheren Preußen, liberalisierten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts den Lehrplan der Ausbildungsstätten, indem lebensnahe Fächer den religionszentrierten Unterricht verdrängten.
Diese Entwicklung wurde nach 1860, befördert durch die großherzogliche Administration, durch den Einfluss der evangelisch-lutherischen Geistlichkeit in Mecklenburg blockiert. Nach Schließung des „freien“ Lehrerseminars in Ludwigslust konnte der verloren gegangene Einfluss der Kirchenadministration in der Lehrerausbildung im neuen Seminar in Neukloster – trotz moderner Lehrmethoden – wieder gesichert werden. Es nützte wenig, dass der Schweriner Arbeiterverein im Landtag für die Schule eine Trennung von Kirche und Staat forderte. Die Kritik der Lehrer an der mangelhaften pädagogischen Kompetenz der vorgesetzten Geistlichkeit, die sie in ihren jährlichen Versammlungen vortrugen, blieb bis zum Ende der Monarchie ohne Resonanz bei den Schulbehörden.
In dieser Studie wird der konfliktreiche Arbeitsalltag des Küsterschullehrers und Organisten Friedrich August Rehm (1849–1935) behandelt. Bei dem Versuch, Regeln der modernen Schulhygiene durchzusetzen, wurde er von dem lokalen Prediger abgestraft. Das daraus resultierende Gerichtsverfahren trieb kuriose Blüten und wurde mit viel Sympathie seitens der mecklenburgischen Lehrerschaft und der Presse außerhalb Mecklenburgs verfolgt. Friedrich Rehm war überdies Autor eigener plattdeutscher Erzählungen und einer der produktivsten Sammelhelfer des Volkskundlers Richard Wossidlo.
Der Verfasser dieser Schrift, ein Enkel Friedrich Rehms, war Direktionsmitglied in der Pharmaindustrie und lehrte an der Universität Zürich.
Band 5: Corpora ethnographica online. Strategien der Digitalisierung kultureller Archive und ihrer Präsentation im Internet
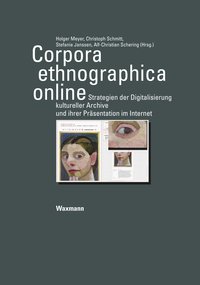
Meyer, Holger; Schmitt, Christoph; Janssen, Stefanie; Schering, Alf-Christian (Hg.): Strategien der Digitalisierung kultureller Archive und ihrer Präsentation im Internet. Waxmann 2014.
Klappentext:
Die Digitalisierung und Publikation wissenschaftlicher Sammlungen im Internet steckt noch in den Kinderschuhen. Dieser Band thematisiert die Onlinestellung ethnographischer Korpora und im weitesten Sinne kultureller Archive. Sammlungen und Nachlässe wegweisender Feldforscher sind aufgrund ihrer eingeschränkten Nutzbarkeit, ihres Umfangs oder ihrer zersplitterten Verwahrung nur schwer zugänglich. Welch ein Gewinn, könnten solche Aufzeichnungen und Sammlungsobjekte als virtuelles Archiv weltweit genutzt werden!
Die hier versammelten Beiträge eines internationalen Symposiums der Universität Rostock skizzieren neu beschrittene Wege, jenen Mehrwert zu erlangen. Ihr Bogen spannt sich vom Aufbau digitaler Feldforschungsarchive der sammlungsintensiven älteren Ethnologen- und Volkskundlergeneration über digitale Briefeditionen bis zur Digitalisierung und Verknüpfung von Museumsobjekten mit Archiv- und Bibliotheksgut. Die Transformation formatreicher Wissensspeicher (Handschriften, Tonaufzeichnungen, Fotos und Filme, entlegenes Druckgut) erfordert verschiedene Lösungsansätze. Fachspezifische Portalentwicklungen, Wege der analogen und digitalen Langzeitarchivierung sowie Retrieval-, Auswertungs- und Darstellungstechniken runden am Beispiel erprobter Digitalisierungsworkflows den Sammelband ab.
Mit Beiträgen von:
Philip Batty, Lital Belinko, Annika Bostelmann, Christiane Cantauw, Gangolf-Torsten Dachnowsky, Elguja Dadunashvili, Frank Dührkohp, Andreas Finger, Jason Gibson, Matthias Harbeck, Franz-Josef Holznagel, Risto Järv, Volker Janke, Pavel Kats, Hendrik Keller, Fabian Kopp, Martin Luchterhandt, Theo Meder, Holger Meyer, Jutta Nunes Matias, Frauke Rehder, Mari Sarv, Alf-Christian Schering, Christoph Schmitt, Manfred Seifert, Barbara Sosič, Jutta Weber, Michael Willenbücher, Christina Wolf, Ginta Zalcmane und Irene Ziehe.
Band 4: Beatrice Vierneisel: Fremde im Land. Aspekte zur kulturellen Integration von Umsiedlern in Mecklenburg und Vorpommern 1945 bis 1953.
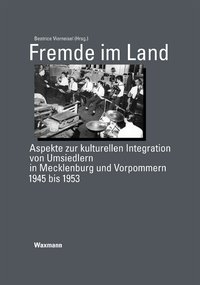
Vierneisel, Beatrice (Hg.): Fremde im Land. Aspekte zur kulturellen Integration von Umsiedlern in Mecklenburg und Vorpommern 1945 bis 1953 (= Rostocker Beiträge zur Volkskunde und Kulturgeschichte, 4). Münster/New York/München/Berlin: Waxmann 2006.
Klappentext:
In Mecklenburg-Vorpommern bildeten die Flüchtlinge und Vertriebenen nach 1945 in vielen Orten die Mehrheit unter der ansässigen Bevölkerung; unter ihnen überwogen die Frauen und Kinder. Ihre soziale und wirtschaftliche Eingliederung war über Jahre ungewöhnlich schwierig. Hier nun wird die Frage gestellt nach der kulturellen Integration der "Fremden" in eine Gesellschaft, in der die niederdeutsche Volkskultur eine lebendige Tradition bildete. Mit dieser "plattdeutschen" Sprache und Kultur waren auch die Pommern, die Ost- und Westpreußen vertraut, die sich in großer Zahl im Land niederließen. Diese Volkskultur konnte sich in der sozialistischen Kulturpolitik langfristig behaupten.
Die Aufsatzsammlung untersucht den Selbstbehauptungswillen der Zugezogenen, die Kirche als Träger religiös-kultureller Werte, Kunst, darunter vor allem Musik als eine der sinnvollsten Möglichkeiten emotionalen Ausdrucks in einer bedrückenden Zeit, die erhaltenswerten Traditionen des Niederdeutschen und die, die sie weiter bewahrten.
Im Westen Deutschlands konnten die Flüchtlinge und Vertriebenen ihre Kulturtraditionen in eigenständigen Vereinen erhalten, in der sowjetischen Zone begann die Kulturpolitik bereits 1946, ihr Konzept "Kunst dem Volke" zu verwirklichen. In der Folge wurden alle kulturellen Tätigkeiten an den Ort der Arbeit gebunden: an Industrie und landwirtschaftliche Betriebe, an Universitäten, Schulen und Verwaltungen. Hier trafen sich alle Gesellschaftsschichten zum gemeinsamen kulturellen Handeln.
Band 3: Erzählkulturen im Medienwandel
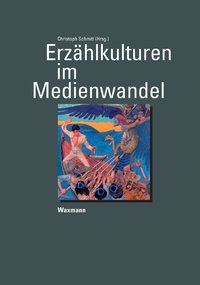
Christoph Schmitt (Hg.): Erzählkulturen im Medienwandel (= Rostocker Beiträge zur Volkskunde und Kulturgeschichte, 3). Waxmann: Münster/New York/London/Paris 2008.
Klappentext:
Medienwandel, methodisch fassbar im Konzept von Intermedialität, gründet auf Medienbegegnung, die zu Medienverschiebung und Medienfusion führt. Dieser Band sucht zu beleuchten, wie populäres Erzählen dadurch beeinflusst wird. Er schildert Erzählprozesse in Abhängigkeit von Mediendifferenzen und Medienkopplungen, zeichnet den Gang traditioneller Motive, Erzähltypen und -gattungen durch die medialen Verwertungsketten nach und fragt, wie Erzählbedürfnisse und Erzähltraditionen ihrerseits die Medien beeinflussen. Um medienhistorische Entwicklungen, Umbruchsituationen und mediale Spezifika fassen zu können, spannt sich der Bogen vom direkten mündlichen Erzählen über das Gedruckte, die Kinematografie und die elektronischen Medien bis zur computergestützten „Netlore“, wobei auch Kunst und Theater nicht fehlen.
Die Beiträge sind das Ergebnis einer an der Universität Rostock veranstalteten Arbeitstagung der Kommission für Erzählforschung, die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert wurde. Der Band signalisiert die Tendenz der „folk narrative researchers“, Narrativität und Medialität künftig stärker in Beziehung zu setzen; dies nicht nur zum fachlichen Selbstverständnis, sondern um den gewachsenen Blickwinkel medienwissenschaftlich interessierten Nachbardisziplinen näher zu bringen. Da Stoffe und Motive, Stile und Darstellungsweisen quer zu den Einzelmedien stehen, wird zugleich eine transmediale Perspektive eröffnet
Band 2: Volkskundliche Großprojekte. Ihre Geschichte und Zukunft. Hochschultagung der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde in Rostock
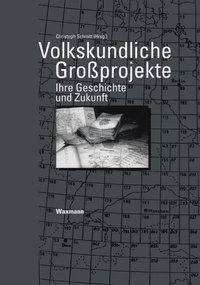
Christoph Schmitt (Hg.): Volkskundliche Großprojekte. Ihre Geschichte und Zukunft. Hochschultagung der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde in Rostock (= Rostocker Beiträge zur Volkskunde und Kulturgeschichte, 2). Münster/New York/München/Berlin: Waxmann 2006.
Klappentext:
Die frühe akademische Volkskunde schuf Großprojekte, aus denen umfangreiche Archive, Handwörterbücher und Atlaswerke hervorgegangen sind. Gegenwärtig sind solche Verbundunternehmen kaum in Sicht. Sollte die Volkskunde/Europäische Ethnologie/Kulturanthropologie ihre Forschungsenergien wieder durch Groß- und Langzeitprojekte bündeln oder sind ihre jetzigen Kooperationsformen ausreichend? Welche Lehren kann das Fach aus seinen bisherigen Projekten ziehen? Welche neuen Fragen sind an das ältere, keineswegs wertlose Material zu stellen? Sind die Dokumente der jüngeren, enger gefassten Forschungsprojekte dauerhaft archivierungswürdig? Wie können sich die volkskundlichen Archive auf dem Markt der neuen Informationsanbieter behaupten, der erweiterte Navigationsmöglichkeiten bietet und Forschungsmaterialien online bereitstellt?
Diesen und anderen Fragen widmen sich dreizehn Referate, die auf einer Hochschultagung der deutschen Gesellschaft für Volkskunde in Rostock gehalten wurden. Ausgehend von Überlegungen zur Wissensproduktion und -präsentation wurden die Konzeptionen und der künftige Wert des "Deutschen Volksliedarchivs", des "Atlas der deutschen Volkskunde", des "Zentralarchivs der deutschen Volkserzählung", der "Enzyklopädie des Märchens", des "Johannes-Künzig-Instituts für ostdeutsche Volkskunde", des "Wossidlo-Archivs" und des Hamburger "Archivs für Alltägliches Erzählen" kritisch befragt. Überdies stellten Gäste aus Finnland und Estland ihre Erfahrungen mit Länder übergreifenden und nationalen Forschungsprojekten vor. Auch thematisiert der Band die Forschungsförderung. Beschlossen wird er mit einer kontrovers geführten Podiumsdiskussion
Band 1: Homo narrans. Studien zur populären Erzählkultur. Festschrift für Siegfried Neumann zum 65. Geburtstag. Hg. von Christoph Schmitt. Waxmann-Verlag: Münster/NewYork/München/Berlin 1999.
Homo narrans. Studien zur populären Erzählkultur. Festschrift für Siegfried Neumann zum 65. Geburtstag, hg. von Christoph Schmitt (= Rostocker Beiträge zur Volkskunde und Kulturgeschichte, 1). Münster/NewYork/München/Berlin: Waxmann 1999.
Klappentext:
Eines der reizvollsten Gebiete der Volkskunde/Europäischen Ethnologie ist die historische und vergleichende Erzählforschung, die nicht nur mündlich vermittelte Volksprosa und populäre Lesestoffe untersucht, sondern auch Problemen moderner Medienforschung nachgeht. In diesem Band mit Beiträgen bekannter Erzählforscher des In- und Auslands erfährt der Leser Hintergründiges über Erzählvorgänge und über die Sammlung, Edition und Deutung von Volkserzählgut in mehreren europäischen Regionen. Gattungsspezifisch spannt sich der Bogen von der mittelalterlichen Legende über Sprichwort und Erzähllied bis zu international verbreiteten Sagen- und Schwankstoffen, die angsterregende, komische oder peinliche Situationen des modernen Alltags schildern. Studien zu medialen Transformationen populärer Erzählstoffe gelten dem mittelalterlichen Altarbild, graphischen Illustrationen und dem modernen Bildwitz oder thematisieren das Erzählen im Hörfunk.
Der Sammelband ist dem Volkskundler, Erzählforscher und Parömiologen Siegfried Neumann zum 65. Geburtstag gewidmet, der als führender Vertreter der Erzählforschung in der ehemaligen DDR gilt und zuletzt das Institut für Volkskunde (Wossidlo-Archiv) an der Universität Rostock leitete. Daher wird die überlieferungsreiche Erzähllandschaft Mecklenburg-Vorpommern mit ihren bekannten Sammlern Richard Wossidlo, Ulrich Jahn und Otto Knoop besonders eingehend behandelt. Dabei lassen Beiträge zu Märchen und Sagen, zum Volkskalender oder zum Heimatlied nach der 'Wende' ein Stück Landesgeschichte auf unterhaltsame Weise Revue passieren.
Mit Beiträgen von Hermann Strobach, Ines Köhler-Zülch, Brigitte Emmrich, Susanne Hose, Kai Detlev Sievers, Leander Petzoldt, Vilmos Voigt, Aleksandr Sergejevic Myl'nikov, Reimund Kvideland, Ingo Schneider, Wilhelm F. H. Nicolaisen, Linda Dégh, Siegfried Becker, Wolfgang Mieder, Lutz Röhrich, Helmut Fischer, Christoph Schmitt, Karl-Ewald Tietz, Kathrin Pöge-Alder, Ralf Wendt, Irmtraud Rösler/Katrin Möller und Heike Müns.